Von Michael Mandelartz
Erschienen in: Herder-Studien (Tokyo), Bd. 5, 1999, S. 127-159 [PDF]
Inhaltsverzeichnis
- Eckermanns Einwand
- Ein Rezeptionsstrang
- Raumverhältnisse
- Pan in Arkadien
- Die Rede des Schaustellers
- Der Burghof
- Theater
- Verschiebungen
An diesem poetischen Faden schlingt man
sich billig durch das Labyrinth dieser
Felsenwände, die steil bis in das Wasser
hinabreichend uns nichts zu sagen haben.
Sie, die Unerschütterlichen, stehen so ruhig da,
wie die Kulissen eines Theaters; Glück oder
Unglück, Lust oder Trauer ist bloß den Personen
zugedacht, die heute auf dem Zettel stehen.
Dichtung und Wahrheit
, IV/18
1. Eckermanns Einwand
Am 15. Januar 1827 werden Eckermann von Goethe die ersten
Manuskriptseiten der Novelle
vorgelegt, am 28. folgen die
letzten.1 Während Eckermann den Beginn des Textes mit umständlichem Lob bedenkt, faßt er dessen Abschluß in seinem Bericht lediglich zusammen und schließt:
Nicht ohne Rührung hatte ich die Handlung des Schlusses lesen können. Doch wußte ich nicht, was ich sagen sollte; ich war überrascht, aber nicht befriedigt. Es war mir, als wäre der Ausgang zu einsam, zu ideal, zu lyrisch, und als hätten wenigstens einige der übrigen Figuren wieder hervortreten und, das Ganze abschließend, dem Ende mehr Breite geben sollen.
Eckermanns Kritik geht, ohne daß er sie genauer darlegen würde, wohl dahin, daß die zu Beginn und während der Entfaltung der Handlung gelegten Fäden an deren Ende nicht wieder aufgenommen werden. Die Novelle
setzt am Hof eines Fürsten ein, dessen Vater seine Aktivitäten im Gefolge der französischen Revolution vom adelstypischen Genuß
auf die moderne Verwaltung und Organisation des Staatswesens verlagerte. Dieser weite Horizont politischen Handelns wird jedoch sofort wieder eingeschränkt: Erzählt wird zunächst von den Vorbereitungen zur Jagd, die in dem modernisierten Staatswesen nur ausnahmsweise noch abgehalten wird. Anschließend verengt sich der Horizont weiter auf einen Ausflug der zurückbleibenden Fürstin in Begleitung des jungen Edelmannes Honorio und des Oheims des Fürsten zur alten Stammburg
. Gegen Ende der Novelle
wird das Feld des Erzählten noch einmal eingeschränkt: nachdem Honorio den während eines Brandes auf dem Marktplatz freigekommenen Tiger erschossen hat, lockt der Sohn der Schaustellerfamilie den ebenfalls befreiten Löwen mittels Flöte und Gesang in den umschlossenen Schloßhof der alten Burg. Nur seine Mutter, der Burgwärter und Honorio sehen dem Geschehen zu bzw. halten die Waffen für alle Fälle bereit.
Es findet sich also eine planmäßige Verengung des Horizonts von der Staatsaktion auf die Jagd, von dieser auf den Ausflug dreier Personen, von diesem auf die Besänftigung des Löwen durch den Jungen, ohne daß die ausgelegten Fäden, insbesondere der Brand auf dem Marktplatz, wieder aufgenommen würden. — Eckermann fährt fort:
Goethe merkte, daß ich einen Zweifel im Herzen hatte, und suchte mich ins Gleiche zu bringen.
Hätte ich, sagte er,einige der übrigen Figuren am Ende wieder hervortreten lassen, so wäre der Schluß prosaisch geworden. Und was sollten sie handeln und sagen, da alles abgetan war? Der Fürst mit den Seinigen ist in die Stadt geritten, wo seine Hülfe nötig sein wird; Honorio, sobald er hört, daß der Löwe oben in Sicherheit ist, wird mit seinen Jägern folgen; der Mann aber wird sehr bald mit dem eisernen Käfig aus der Stadt da sein und den Löwen darin zurückführen. Dieses sind alles Dinge, die man voraussieht und die deshalb nicht gesagt und ausgeführt werden müssen. Täte man es, so würde man prosaisch werden.2
Aber ein ideeller, ja lyrischer Schluß war nötig und mußte folgen; denn nach der pathetischen Rede des Mannes, die schon poetische Prosa ist, mußte eine Steigerung kommen, ich mußte zur lyrischen Poesie, ja zum Liede selbst übergehen.
Es leuchtet kaum ein, daß alles abgetan war
, denn ein Höhepunkt der Novelle
lag in der Entdeckung des Brandes auf dem Marktplatz. Goethe tut das Interesse an diesem Hauptpunkt mit der Bemerkung ab, daß des Fürsten Hülfe nötig sein wird
, als ob damit die Frage geklärt wäre, ob der Brand gelöscht wird oder ob Markt, Stadt, das nahegelegene Schloß und damit die Herrschaft des Fürsten zerstört werden. Auf dem Spiel steht tatsächlich das zu Beginn eingeführte Staatswesen als Ganzes, und es ist sehr die Frage, ob die idyllische Besänftigung des Löwen zugleich auch bedeutet, daß das Feuer im Zentrum der Stadt keinen größeren Schaden anrichtet. Eine ursächliche Beziehung besteht jedenfalls nicht, und Honorios Beteuerung, in der Stadt wie auf dem Schloß [seien] die Feueranstalten in bester Ordnung, man [werde] sich durch einen so unerwartet außergewöhnlichen Fall nicht irre machen lassen
,3 wird man mit Mißtrauen begegnen: Nach des Schaustellers Bericht breitet sich der Brand durch einen Pulverschlag
(506) aus; man hat also unvorsichtigerweise explosive Stoffe auf dem Marktplatz gelagert. Auch wissen wir aus den Wahlverwandtschaften
, daß rationale Vorsorge für Katastrophenfälle nur sehr bedingt Sicherheit gewährt.4
Es besteht also einiger Anlaß, Eckermanns Bedenken ernstzunehmen und umgekehrt Goethes Versuch, sie auszuräumen, mit Mißtrauen zu begegnen. Möglicherweise handelt es sich bei Goethes Selbstauslegung mehr um eine Irreführung des Lesers Eckermann und seiner Nachfolger als um eine Hilfestellung. Jedenfalls wäre sie am Text erneut zu überprüfen.
2. Ein Rezeptionsstrang
Nun ergibt sich das konstatierte Ungleichgewicht zwischen dem in der Erzählung unterschlagenen
Ausgang des Brandes und der gegen Ende im Mittelpunkt stehenden Friedensszene nur dann, wenn letztere als Goethes Aussage zur Möglichkeit eines gesellschaftlichen Friedens, also als utopische Vorwegnahme einer zu realisierenden Option
verstanden wird. Denn liest man die Novelle
auf diese Weise realistisch, so sind die Folgen der Friedensszene für das Staatswesen von unmittelbarem Interesse. Insbesondere im Anschluß an Emil Staigers Interpretation5 hat sich diese Auffassung weitgehend durchgesetzt.6 Es käme danach nur darauf an, dem Gewaltverzicht eine Chance einzuräumen, um einer neuen, friedlichen Gesellschaft den Weg zu bahnen. Ein fester Bestandteil dieser Interpretation ist der Einfluß der Bilder der Einbildungskraft auf die Handlungen des Personals. So wird die wiederholte Erzählung des Fürst-Oheims von einer früheren Brandkatastrophe dafür verantwortlich gemacht,
daß im Geist der Fürstin [...] das Bild des 'wüsten Wirrwarrs' auf[steigt], das ihr der Oheim ausgemalt. Nicht dieser Brand, nur die Erinnerung an den oft vernommenen Bericht ist's, was sie nun verstört [...].
7 Als ob die Katastrophe in der Verstörung der Einbildungskraft, nicht aber im Brand auf dem Marktplatz läge! Honorios Erlegung des Tigers wird gar als Frevel
8 bezeichnet, der sich dem anachronistischen Einfluß des mittelalterlichen Ritterbildes verdanke. Gewalt wird nach dieser Auffassung nur durch den falschen Einsatz von Bildern erzeugt — die Wirklichkeit an sich selbst sei friedlich, geradezu einem Paradiese vergleichbar, dem nur eine Chance gegeben werden müsse. — Sie wird ganz einfach aus der Betrachtung
ausgeschlossen.
Während und nach den Schrecken des zweiten Weltkrieges verfaßt, hat Staigers Aufsatz als ein Versuch, gewaltfreier Politik Anerkennung zu verschaffen, sicherlich seinen historischen Platz. Über ein halbes Jahrhundert später sollte es aber möglich sein, sich den sehr spezifischen Verhältnissen der Goetherezeption in der Nachkriegszeit zu entziehen und den Text der Novelle
erneut in den Blick zu nehmen.
Das Schlußbild wird bei Staiger und seinen Nachfolgern eindimensional als utopische Vorwegnahme eines ewigen Friedens aufgefaßt, demgegenüber die katastrophische Wirklichkeit kaum in Betracht kommt. Im folgenden soll dagegen versucht werden, das Thema der Novelle
anders zu bestimmen: Es geht weniger um Handlungsoptionen in der Realität als um die Möglichkeiten der Kunst in dieser Wirklichkeit. Betrachten wir nicht nur die vom Oheim in Auftrag gegebenen Bilder des Stammschlosses als Kunstwerke, sondern auch die 'Zähmung' des Löwen — der ja tatsächlich der Zähmung kaum bedurfte, da er schon vorher zahm war9 — im geschlossenen Areal des Hofes der Burgruine, so stellt sich die Blickverengung vom Staatswesen auf ein Spiel zwischen Mensch und Tier mit zwei Zuschauern, weitab von der Brandkatastrophe in der Stadt, ganz anders dar: Die Konzentration auf die abgelegene Schlußszene entspricht dem der Wirklichkeit entrückten und möglicherweise weitgehend irrelevanten Status der Kunst in ihr. Während 'unten', in der Wirklichkeit, das Feuer tobt, spielt 'oben' im Burghof die Kunst davon unbeeindruckt ihr Spiel. Damit wird ihr nicht notwendigerweise jede Funktion innerhalb der gesellschaftlichen Wirklichkeit abgesprochen, aber doch ein geradliniger erzieherischer Zusammenhang nach Schillers Modell — oder auch nach Staiger — bezweifelt. Möglicherweise käme eine solche Interpretation der Skepsis des späten Goethe hinsichtlich der Wirkungsmacht der Kunst, wie sie sich etwa in seinem Entschluß äußert, Faust II
erst nach seinem Tode veröffentlichen zu lassen, näher als der Versuch, die Novelle
als Produkt eines abgeklärten, friedlichen Geistes zu verstehen.
3. Raumverhältnisse
Wir beginnen mit einer Analyse der Raumverhältnisse.10 Sie lassen sich, wie schon Eckermann bemerkte,11 leicht nachvollziehen,12 und bieten so eine stabile Basis für die Interpretation. Vergleiche mit den Wahlverwandtschaften
13 und Faust II
werden bei der Klärung der symbolischen Implikationen des Raumes hilfreich sein. Die Ausgangslage der Novelle
entspricht in vielem der der Wahlverwandtschaften
: es ist eine gewisse Höhe der Zivilisation erreicht worden, die als gesichert gilt. In der Novelle
ist dies ein aufgeklärtes Staatswesen, das die Gewalt als Herrschaftsmittel des Feudalismus durch eine bürgerliche Ökonomie ersetzt hat, die alle Staatsglieder in gleiche Betriebsamkeit
(491) versetzt, so daß jedermann mehr empfange als gebe
(496) und der ökonomische Vorteil des Einzelnen dem Ganzen zugute kommt. Insbesondere am Markt als Umschlagplatz von Bedürfnissen und Waren läßt sich feststellen, wie sehr dieses gelungen war
(491). Gleichgültig, ob die ökonomische Neuorientierung nun an die französische Revolution oder eher an den aufgeklärten Absolutismus anschließt:14 Der Einrichtung eines prosperierenden, friedlichen Staatswesens, das sich seit einem Menschenalter bewährt hat, soll nun durch die ästhetische Aneignung von Natur und Geschichte die abschließende Krone aufgesetzt werden. In den Wahlverwandtschaften
glaubt man beides durch den Bau des neuen Lustgebäudes mit der außerordentlich schön[en]
(6/295) Aussicht auf die alte, im Tal gelegene Mühle und die fernen Gebirge (Natur) einerseits, mit der Restaurierung der gotischen Kapelle und der Umgestaltung des Friedhofs (Geschichte) andererseits realisieren zu können. Die Novelle
dagegen vereint beide Aspekte, Natur und Geschichte, in der Ruine der alten Stammburg. Sie repräsentiert einerseits die Herkunft der zivilisierten Gegenwart aus der mittelalterlichen Gewaltherrschaft der Vorfahren des Fürsten, also den historischen Aspekt, andererseits aber ist an ihr nicht mehr zu unterscheiden, wo die Natur aufhört, Kunst und Handwerk aber anfangen.
(493) Indem Natur und Geschichte in der Stammburg gleichermaßen präsent sind, übernimmt sie die Funktion von Lustgebäude und Kirche aus den Wahlverwandtschaften
. An Hinweisen, die die Stammburg den feudalen Gewaltverhältnissen des Mittelalters zuordnen, fehlt es nicht: Die vom Fürst-Oheim in Auftrag gegebenen Zeichnungen machen anschaulich, wie der mächtige Trutz- und Schutzbau von alten Zeiten her dem Jahr und der Witterung sich entgegenstemmte
(493). Umgeben von Ringmauern, die nur einen einzigen Zugang durch einen beidseitig vermauerten Hohlweg offenlassen (vgl. 493 und 506), zeigt sich der Bau geprägt von dem Willen zur Gewaltherrschaft über andere und der Verteidigung des Eigenen, eben als Trutz- und Schutzbau
, wenn man 'Trutz' in seiner eigentlichen Bedeutung auf das Verb 'trotzen' bezieht.
Damit steht er in genauem Gegensatz zum Schloß, das sich mit seiner Vorderfront der Stadt und dem Markt öffnet, sich der Welt zuwendet statt sich ihr entgegenzustemmen. Wie das Schloß der Wahlverwandtschaften
liegt es von dem Flusse herauf in einiger Höhe
(492). In beiden Fällen steht die Lage auf halber Höhe für den Fortschritt im Zivilisationsprozeß, der in den Wahlverwandtschaften
von unten nach oben (Mühle, Kirche, Schloß, Mooshütte und Lustgebäude folgen einander in der Aufwärtsbewegung wie im historischen Verlauf), in der Novelle
dagegen von oben nach unten verläuft.15 Die französischen Gärten, in der Novelle
vom Fürst-Oheim als unsere regelmäßigen Parterre, Lauben und schattigen Gänge
(495) und in den Wahlverwandtschaften
als die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Vater herschrieben
(6/417) zitiert, wurden in beiden Fällen zur Zeit der Aufklärung und in deren Geist konzipiert. Auch auf das Schloß der Novelle
könnte daher wohl der Satz des Hauptmanns aus den Wahlverwandtschaften
Anwendung finden: Das Schloß haben die Alten mit Vernunft hieher gebaut, denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen täglichen Bedürfnissen
(6/295); ganz im Gegensatz zur Stammburg, die auf dem Berggipfel sowohl den Winden ausgesetzt ist als auch fernab vom städtischen Markt liegt, der die Bedürfnisse befriedigt. Die Differenzen zwischen Schloß und Ruine betreffen jedoch mehr als einen bloßen Epochenunterschied. Die Burg repräsentiert vielmehr wie die Mühle der Wahlverwandtschaften
den Ursprung der Kultur, der mit der Natur noch untrennbar verwachsen ist und sich ihr nur mühsam entringt. Damit besteht zwischen Schloß und Stammburg eine qualitative Differenz, die den Protagonisten zugleich die Richtung sinnvollen Handelns vorgibt: auf das Erreichte aufbauend, bestände die Aufgabe darin, den Zivilisationsprozeß weiterzuführen. Daß die handelnden Personen in der Novelle
ebenso wie in den Wahlverwandtschaften
diese Richtung in dem Wahn umkehren, sie könnten ihr gesichertes Dasein durch die ästhetische Einbeziehung einer Vergangenheit 'abrunden', die im Widerspruch zum erreichten Zivilisationsniveau steht, wird im folgenden zu zeigen sein. Entgegen der geläufigen Annahme, die ästhetische Aneignung der Ruine in Form von Zeichnungen, die, als Gemälde ausgeführt, den Gartensaal zieren
(495) sollen, laufe auf eine höhere Zivilisationsstufe hinaus, ja stelle gar Goethes politisches Ideal
16 dar, geht nämlich gerade von ihr die Bedrohung aus. Ebenso wie die Jagd und die Turnierspiele, in denen Honorio glänzt, hat die Burg ihren ehemals praktisch-kriegerischen Charakter scheinbar abgestreift und soll nun dem Vergnügen dienen. Während aber Jagd und Turnierspiel auch von den Interpreten ganz überwiegend als anachronistische Relikte einer überwundenen Zivilisationsstufe und damit als Bedrohung des Friedens aufgefaßt werden,17 wird der Ruine der Stammburg als solcher, insbesondere aber ihrer Vergegenwärtigung in den Zeichnungen und dem Restaurierungsversuch zugestanden, sie trügen zur Pazifizierung der Gesellschaft bei.
Diese These scheint fragwürdig, steht sie doch im Widerspruch zum historischen Verlauf. Denn der Zivilisationsprozeß hat gewissermaßen schon 'von selbst' dafür gesorgt, daß seine Ursprünge sich im Dunkel verlieren und sich der Aneignung widersetzen. Die Ruine der Stammburg ist mit freiem Auge von dem Schloß auf halber Höhe her kaum noch zu sehen: Dem historischen Abstand entspricht die räumliche Distanz. Diese wird wie jener zur 'Schwelle', die nur durch eine besondere Anstrengung überwunden werden kann. Funktional gesehen sichert die zeitliche und räumliche Schwelle der gegenwärtigen Gesellschaft ihre Funktionstüchtigkeit. Hat sie sich einmal etabliert und von der feudalen Vorgängergesellschaft abgegrenzt, bedarf sie ihres eigenen Gravitationszentrums, das hier die Ökonomie stellt. Richtet sie sich an einem anderen Schwerpunkt aus, etwa an der Gewaltherrschaft der Vorfahren, und sei es nur als romantisiertes ästhetisches Ideal, wird ihre Funktionsweise empfindlich gestört.
Mindestens zwei solcher Schwellen, die den Zugang zur Burg erschweren, werden in der Novelle
deutlich markiert, und beide werden mit einigem Aufwand überschritten: zum einen ist, wie gesagt, die Ruine vom Schloß her nicht sichtbar. Dem setzt man die Distanzen aufhebende Technik des Teleskops entgegen:
Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in den Schloßhof hinab mit dem Schnupftuch nachgewinkt hatte, begab sich in die hintern Zimmer, welche nach dem Gebirg eine freie Aussicht ließen, die um desto schöner war, als das Schloß selbst von dem Flusse herauf in einiger Höhe stand und so vor- als hinterwärts mannigfaltige bedeutende Ansichten gewährte. Sie fand das treffliche Teleskop noch in der Stellung, wo man es gestern abend gelassen hatte, als man, über Busch, Berg und Waldgipfel die hohen Ruinen der uralten Stammburg betrachtend, sich unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alsdann die größten Licht- und Schattenmassen den deutlichsten Begriff von einem so ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleihen konnten. (492)
Der Erzähler unterscheidet hier sehr genau zwischen dem Blick mit unbewaffnetem Auge und dem durchs Teleskop: Die Ruine gehört keineswegs zu der freien, mannigfaltige bedeutende Ansichten
gewährenden Aussicht aus den rückwärtigen Fenstern des Schlosses. Sie wird vielmehr erst in Verbindung mit dem Teleskop erwähnt und der Aussicht durchaus entgegengesetzt: Die Stammburg befindet sich über
der Landschaft, die dem freien Auge noch sichtbar ist: Busch, Berg und Waldgipfel
. Einen deutlichen, ja sogar den deutlichsten
Begriff erhält man erst alsdann
, also bei Benutzung des Teleskops. Die Stammburg erscheint im Blick durch das Fernrohr auf eine Weise, die weder der historisch-kulturellen noch der ihr entsprechenden räumlichen Distanz angemessen ist.
Goethes Abneigung gegen Sehhilfen ist bekannt.18 So heißt es in Wilhelm Meisters Wanderjahren: Mikroskope und Fernröhre verwirren eigentlich den reinen Menschensinn
(8/292), und zwar, wie Wilhelm gegenüber dem Astronomen anläßlich der Betrachtung des Jupiter durch ein Teleskop äußert, durch Verschiebung der Proportionen:
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alles Maß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Verhältnis zu dem übrigen Unzähligen des Himmels und zu mir selbst; jetzt aber tritt es in meiner Einbildungskraft unverhältnismäßig hervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Scharen gleicherweise heranzuführen wünschen sollte. Sie werden mich einengen, mich beängstigen. (8/120)
Und weiter:
Wer durch Brillen sieht, hält sich für klüger, als er ist, denn sein äußerer Sinn wird dadurch mit seiner innern Urteilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesetzt; es gehört eine höhere Kultur dazu, deren nur vorzügliche Menschen fähig sind, ihr Inneres, Wahres mit diesem von außen herangerückten Falschen einigermaßen auszugleichen. Sooft ich durch eine Brille sehe, bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir selbst nicht; ich sehe mehr, als ich sehen sollte, die schärfer gesehene Welt harmoniert nicht mit meinem Innern, und ich lege die Gläser geschwind wieder weg, wenn meine Neugierde, wie dieses oder jenes in der Ferne beschaffen sein möchte, befriedigt ist. (8/120f)
Indem die Stammburg durch das Fernrohr 'unverhältnismäßig hervortritt', besteht zwischen dem ihr eigentlich zukommenden mythischen Dunkel jenseits des historischen Abstandes und der zivilisatorischen Kluft einerseits sowie dem durch das Fernrohr gewonnenen deutlichsten Begriff
andererseits eine Diskrepanz, die sich insbesondere bei der Fürstin sofort bemerkbar macht. Auch in anderen Fällen äußert sich ihre leicht erregbare Einbildungskraft, so wenn die Erzählungen des Fürst-Oheims von einem Brand sie ängstigen oder die grellen Bilder von Löwen und Tigern an der Schaubude sie animieren, die seltenen Gäste näher [zu] betrachten
(497). Ebenso verlangt es sie nach dem Blick durch das Fernrohr und auf die vom Oheim erläuterten Zeichnungen, die Ruine in der Wirklichkeit
(495) zu sehen. Sie scheint also nicht gerade zu den Menschen höherer Kultur
zu gehören, die ihr Inneres, Wahres
mit dem von außen herangerückten Falschen
auszugleichen in der Lage sind.
Ohne den Blick durch das Fernrohr hätte der Tagesausflug von Fürstin, Oheim und Honorio zur Stammburg nicht stattgefunden. Die Novellenhandlung beruht von Anfang an auf der technisch induzierten Disproportion zwischen der historischen Wirklichkeit und ihrer Vorstellung. Dies umso mehr, als man wohl auch annehmen darf, daß der Oheim die Zeichnungen der Stammburg kaum in Auftrag gegeben hätte, wenn sein Interesse nicht durch die Gespräche geweckt worden wäre, die sich dem Blick durchs Fernrohr anschlossen.
Die zweite Schwelle besteht in der öden, steinigen Fläche
(493), die der Fürstin schon zu Beginn beim Blick durch das Fernrohr zu Gesicht kommt und später den Schauplatz für Honorios Schuß auf den Tiger abgibt. Es ist erstaunlich, daß der Schwellencharakter dieses auffälligen Raumes bisher kaum wahrgenommen wurde, denn als Schwellenraum wird er in nahezu jeder
Hinsicht charakterisiert: optisch, physisch und symbolisch. Seine mit Felstrümmern übersäte Ödnis bildet den größten Kontrast zwischen dem idyllischen, sammetähnlich anzusehen[den]
(498) Wiesental und dem Fels- und Waldgipfel
(498) der Ruine; er erschwert den Aufstieg, indem er selbst dem Kühnsten jeden Angriff zu verbieten
(499) scheint, und schließlich wird an dieser Stelle Pan zitiert: Über die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pflegt, wo die Alten sagen, Pan schlafe und alle Natur halte den Atem an, um ihn nicht aufzuwecken.
(499f)
Der Ödnis als Schwelle, als Hindernis, das den Zugang zur Vergangenheit erschwert, kommt bei Goethe auch im Verhältnis zur Antike Bedeutung zu. Dies überrascht, da doch Rom als klassische Lokalität noch dem späten Goethe näher steht als die Mittelaltersehnsucht der Romantiker. Es kommt hier aber weniger auf die Wertschätzung der jeweiligen Vergangenheit als auf ihre Andersartigkeit an, darauf, daß sie der Gegenwart unvergleichbar ist. In diesem Sinne bestimmt sogar der Oheim die Stammburg als zufällig einziges Lokal
(493). — Unter dem Kapitel Rom
teilt Goethe in Winckelmann und sein Jahrhundert
einen Brief Wilhelm von Humboldts19 mit, in dem Rom, ähnlich wie die Stammburg, jedem Vergleich entzogen wird: Wie Homer sich nicht mit andern Dichtern, so läßt sich Rom mit keiner andern Stadt, römische Gegend mit keiner andern vergleichen.
(12/108) Fühlbar aber wird die Unvergleichbarkeit und mit ihr der historische Abstand nur durch die chaotischen Zustände im Innern und die Wüstenei
in der Umgebung Roms. Humboldt verwahrt sich gegen den Versuch, Ordnung schaffen zu wollen, und selbst gegen Ausgrabungen, weil beides die ursprüngliche Fremdheit der Antike aufheben würde:
Nur aus der Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen muß das Altertum uns erscheinen. Es geht damit, wie wenigstens mir und einem Freunde mit den Ruinen. Wir haben immer einen Ärger, wenn man eine halb versunkene ausgräbt; es kann höchstens ein Gewinn für die Gelehrsamkeit auf Kosten der Phantasie sein. Ich kenne für mich nur noch zwei gleich schreckliche Dinge: wenn man die Campagna di Roma anbauen und Rom zu einer polizierten Stadt machen wollte, in der kein Mensch mehr Messer trüge. Kommt je ein so ordentlicher Papst, was denn die 72 Kardinäle verhüten mögen, so ziehe ich aus. Nur wenn in Rom eine so göttliche Anarchie und um Rom eine so himmlische Wüstenei ist, bleibt für die Schatten Platz, deren einer mehr wert ist als dies ganze Geschlecht. (12/109)
Die Wüstenei
zieht um Rom wie auch um die Stammburg eine
Art magischen Kreis, hinter dem die Antike bzw. das Mittelalter in
einem die Phantasie anregenden Dunkel nahezu verschwinden. Wenn der
Oheim bekennt, er habe manches getan, um diese Wildnis
zugänglicher zu machen, denn mehr bedarf es nicht, um jeden
Wanderer, jeden Besucher in Erstaunen zu setzen, zu entzücken
(493), so leitet er genau jene 'Polizierung' ein, die die Ruine als
Park in die Gegenwart einbezieht und damit den tatsächlichen
Abstand zwischen Mittelalter und Gegenwart scheinbar und
irreführend aufhebt. Der deutlichste Begriff
von der
Stammburg wird um den Preis gewonnen, daß man sich über die
grundlegende Fremdheit täuscht, die das Mittelalter von der
'aufgeklärten' Gesellschaft trennt.
Nachdem man den steinigen Abhang emporgeklommen ist und ein Felsplateau
oberhalb oder doch im oberen Bereich der öden, steinigen
Fläche
erreicht hat, genießt man den Blick auf die
Landschaft. Anders als beim ersten Aussichtspunkt, bei dem sich ohne
das Fernrohr ein klar strukturierter Überblick ergab, hat man
jedoch hier eine solche Höhe erreicht, daß die Ansicht
schon in den Blick des Vogels überging
(499). Obwohl man
daher das Fernrohr zu Hilfe nimmt, läßt sich kein
Überblick mehr über die Zahl der Ortschaften gewinnen: es
war längst herkömlich, über die Zahl zu streiten,
wieviel man deren von hier oben gewahr werde.
(499) Im Blick durch
das Fernrohr von oben auf Schloß und Stadt zeigt sich eine
ähnliche Schwelle wie in der umgekehrten Richtung, vom
Schloß auf die Ruine: Zwar gewinnt das Einzelne den 'deutlichsten
Begriff' — Honorio bemerkt von hier aus selbst den Brand auf dem
Marktplatz — doch indem das Detail 'unverhältnismasig
hervortritt', geht der Zusammenhang mit dem Ganzen auch hier verloren.
Die öde Fläche bildet in beiden Richtungen die Grenze,
jenseits derer eine deutliche, ausgewogene Erkenntnis unmöglich
wird.
4. Pan in Arkadien
Verschiedentlich wurde schon auf den ambivalenten Charakter Pans
hingewiesen,20 den Goethe betont, wenn er dem schon zitierten
Passus (s.o.) zunächst die
Bemerkung der Fürstin folgen läßt: wie doch die
klare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindruck
verleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein
könne
(500), und anschließend Honorio den Brand
entdeckt, bevor dann auch noch der Tiger auftaucht. Bei dieser
zeitlichen Koinzidenz scheint es fast, als ob die Ausflügler
selbst die Stille aufrührten, die sie genießen, als ob es
einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Auftritt der Gruppe
in der Mittagsstille der Ödnis und dem anschließenden
Ausbruch der Natur auf dem Marktplatz gäbe. Es bleibt hier beim
Als-Ob
. Der Erzähler gibt keinen Hinweis auf einen
ursächlichen Zusammenhang, und doch fällt die Erwähnung
Pans an dieser Stelle zu sehr in die Augen, um nicht wenigstens auf
einen symbolischen Zusammenhang hinzuweisen.
Wenn Feuer und Tiger als Ausdruck des panischen
Schreckens
angesehen werden, den der in der Mittagsruhe gestörte Pan
verbreitet, dann befindet sich die Gruppe auf der öden Fläche
offenbar im Eingangsbereich von Pans Reich, also auf der Schwelle zu
Arkadien. Arkadien aber hat man sich als umschlossenes Gebiet zu
denken, dessen Friede nur durch diese Abgeschlossenheit gesichert
wird.21 Die Grenze wird hier mit der öden
Fläche gesetzt, Pan reagiert mit Feuer und Tiger auf die
Grenzverletzung.
Zur Stützung dieser Deutung sei eine Parallelstelle aus Faust
II
angeführt. Die Ausarbeitung des Helenaaktes, um den es hier
geht, überschneidet sich zeitweise mit der Arbeit an der
Novelle
, oder genauer: umrahmt
22 sie.
Gegen Ende der Szene Innerer Burghof
wird Helena von Faust die
Aussicht auf ein gemeinsames Leben in Arkadien eröffnet, das in
der nächsten Szene, Schattiger Hain
, realisiert wird. Voran
geht die Belehnung der Heerführer mit den umliegenden
Ländern, so daß Arkadien zum umschlossenen, geschützten
Bezirk wird: Und sie beschützen um die Wette, / Ringsum von
Wellen angehüpft, / Nichtinsel dich, mit leichter Hügelkette
/ Europens letztem Bergast angeknüpft.
(3/287, V. 9510-14)
Einige Strophen später werden die Rinder angeführt, die in
Höhlen eine Unterkunft finden: Pan schützt sie dort, und
Lebensnymphen wohnen / In buschiger Klüfte feucht erfrischtem
Raum, / Und sehnsuchtsvoll nach höhern Regionen / Erhebt sich
zweighaft Baum gedrängt an Baum.
(V. 9537-41) Die Idylle wird
wie in der Novelle
von Pan geschützt, in den oberen
Regionen stehen dicht gedrängt die Bäume, deren Alter auch
hier hervorgehoben wird: Alt-Wälder sind's! Die Eiche starret
mächtig, / Und eigensinnig zackt sich Ast an Ast; / Der Ahorn
mild, von süßem Safte trächtig, / Steigt rein empor und
spielt mit seiner Last
(V. 9542-45), heißt es in Faust
II
, während der Oheim in der Novelle
sagt: Es ist
eigentlich ein Wald, der diesen uralten Gipfel umgibt. Seit
hundertundfünfzig Jahren hat keine Axt hier geklungen, und
überall sind die mächtigsten Stämme emporgewachsen
(493). Selbst der Ahorn taucht — in Goethes poetischen Werken
insgesamt nur an diesen beiden Stellen erwähnt23 —
in ähnlicher Funktion auf. Dem steigt empor
in Faust II
entspricht in der Novelle
der in den Turmstufen wurzelnde und
die Zinne krönende Ahorn. (494)
In dieser, durch ähnliche Attribute gekennzeichneten arkadischen Landschaft tritt dann das Kind des Friedens auf:
Und mütterlich im stillen Schattenkreise
Quillt laue Milch bereit für Kind und Lamm;
Obst ist nicht weit, der Ebnen reife Speise,
Und Honig trieft vom ausgehöhlten Stamm.
Hier ist das Wohlbehagen erblich,
Die Wange heitert wie der Mund,
Ein jeder ist an seinem Platz unsterblich:
Sie sind zufrieden und gesund.
Und so entwickelt sich am reinen Tage
Zu Vaterkraft das holde Kind.
Wir staunen drob; noch immer bleibt die Frage:
Ob's Götter, ob es Menschen sind?
So war Apoll den Hirten zugestaltet,
Daß ihm der schönsten einer glich;
Denn wo Natur im reinen Kreise waltet,
Ergreifen alle Welten sich.
Neben ihr [Helena] sitzend.
So ist es mir, so ist es dir gelungen;
Vergangenheit sei hinter uns getan!
O fühle dich vom höchsten Gott entsprungen,
Der ersten Welt gehörst du einzig an.
Nicht feste Burg soll dich umschreiben!
Noch zirkt in ewiger Jugendkraft
Für uns, zu wonnevollem Bleiben,
Arkadien in Spartas Nachbarschaft. (S. 288, V. 9546-9569)
Die Parallelen zur Novelle
sind wohl kaum übersehbar,
ebensowenig aber auch die Differenzen: geht der Weg in der
Novelle
von der offenen Landschaft in den umschlossenen Burghof,
so führt er im Faust
umgekehrt aus der Burg heraus ins
Freie. Während das Kind im Faust als Bürge des arkadischen
Friedens eingeführt wird und sich später als kriegerischer
Jüngling enthüllt,24 wird das Kind in der
Novelle
zunächst mit Tiger und Löwen in Verbindung
gebracht und stellt später den Frieden her, den Euphorion in
Faust II
zerstört. Dementsprechend liegt es im Faust
beim Lamme, in der Novelle
beim Löwen. Wird Faust aus dem
Traum25 der Kunst von der Einheit des Mittelalters und
der Antike in die kriegerische Wirklichkeit zurückgeholt, so
entfernen sich dagegen Kind und Löwe — wie man nun
schließen könnte — umgekehrt aus der Wirklichkeit der
Jagd in den umhegten Bezirk der Kunst, der sich hier im friedlichen
Miteinander von Löwe und Kind, Natur und Kunst,
(morgenländischem) Altertum, Mittelalter und Gegenwart darstellt.
Der dritte Akt von Faust II
und die Novelle
sind deutlich
als Gegenbilder aufeinander bezogen. Die Elemente sind zwar bis ins
Einzelne identisch, verhalten sich aber in umgekehrter Proportion
zueinander. Das gilt für die Gegensatzpaare Friede und Krieg/Jagd,
Landschaft und Burg, Natur und Kunst, Wirklichkeit und Traum. Dies
heißt aber auch, daß es weder in Faust
noch in der
Novelle
nur um Kunst oder Realität geht, sondern jeweils um
deren Widerspiel. Der Bezirk der Kunst, die Stammburg, bleibt auf die
Realität von Stadt und Schloß bezogen wie Arkadien auf
Sparta (bzw. Griechenland als Ganzes auf das ritterliche Mittelalter),
auch wenn die öde Fläche eine deutliche Grenze markiert und
Fürst, Fürstin und Gefolge von dort zur Stadt hinabziehen,
während der Erzähler Mutter und Kind, Wärtel und Honorio
zur Burg hinauf folgt.
Die ausgewählte Gruppe, die schließlich Zutritt in das Arkadien der Stammburg erhält, wird gewissermaßen angeführt von dem Knaben. Mit dem Attribut der Flöte wird er geradezu mit der befriedenden Seite Pans identifiziert: nachdem die unerwünschten Eindringlinge erschreckt und in ihren angestammten Bereich zurückgeschickt wurden, geleitet Pan in Gestalt des Kindes die kleinere Gruppe in das Friedensreich der Kunst.
5. Die Rede des Schaustellers
Bevor wir uns dem Burghof als dem Zentrum des Geschehens zuwenden, ist die Rede des Schaustellers zu bedenken. Sie wird noch auf der öden Fläche gehalten und spiegelt die Zweideutigkeit dieses Grenzraums in allen ihren Teilen. Herman Meyer hat in seiner ausgedehnten Analyse auf den biblischen Ursprung vieler Bilder aufmerksam gemacht, die Elemente der Rede und ihre Komposition bis zur ägyptischen Listenwissenschaft zurückverfolgt und als ein Strukturmodell bestimmt, das sich an die Goethesche Morphologie anlehne. All dies soll hier nicht bestritten werden; es scheint aber, daß über dem Versuch, in die verwirrende Rede des Schaustellers eine Ordnung zu bringen, ihre grundlegende Ambivalenz zu sehr in den Hintergrund tritt. Um diese herauszuarbeiten, empfiehlt sich ein analytischer Zugriff.
Auf den ersten Blick äußert sich in der Rede eine
krause
Logik. Sinn
, d.h. ein nachvollziehbarer
Zusammenhang, wird zwar intendiert, aber kaum hergestellt. Sieht man
genauer zu, so ergibt sich dennoch ein klares Muster. Jeder Abschnitt
beginnt mit einer leicht nachvollziehbaren Allegorie für die
Allmacht des Herrn: der Felsen trotzt der Witterung und schaut, von
Bäumen gekrönt, weit umher; Biene und Ameise bauen ihr Haus
nach den Regeln der Geometrie bzw. verlieren ihren Weg nicht; der
Löwe herrscht über alles Getier. Auf ein aber
bzw.
doch
folgt jeweils die Gegenthese: der Felsen stürzt in
Trümmern herunter, das Pferd zerstampft den Ameisenhaufen, und der
Mensch zähmt den Löwen. Den Regeln der Logik nach sollte nun
ein Schluß gezogen, eine Entscheidung zwischen den Alternativen
getroffen oder, im Sinne Hegels, eine Synthese eröffnet werden.
Statt dessen schweift der Redner ab: die Steine gelangen zum Ozean, wo
die Riesen in Scharen daherziehen und in der Tiefe die Zwerge
wimmeln
das Pferd trägt den Mann, wohin er will, und die
Frau, wohin sie begehrt.
Daniel bleibt in der Grube fest und
getrost, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen frommen
Gesang.
(507f) Zwar werden Steine, Pferd und Löwe noch in den
Schlüssen erwähnt, der Zusammenhang der Rede bleibt also
'irgendwie' gewahrt, was aber die Riesen, die Frau und der Gesang
Daniels noch mit dem festen Felsen, der Biene und dem königlichen
Löwen zu tun haben, bleibt des Redners Geheimnis. Indem die Rede
sich selbst nicht einmal nachvollziehbar widerspricht, sondern in einem
der klassischen Logik vergleichbaren Dreischritt von Obersatz,
Untersatz und Schluß eben dieses logische Schema außer
Kraft setzt, hebt sie den Sinn, den sie aufzuzeigen antritt, im selben
Schritt auf. Die Rede, auf einem Trümmerfeld gehalten, wird selbst
zu einem Trümmerfeld des Denkens.
Von hier ab ist ein näheres Eingehen auf Goethes geologisches
Denken notwendig, insbesondere auf den zentralen Aufsatz von 1784:
Über den Granit
. Er wird sich in der Folge, v.a. bei der
Analyse der Schlußszene, als entscheidender Hebel der Deutung
erweisen. Im Zusammenhang der Schaustellerrede ziehen wir einen Passus
aus dem letzten Teil heran:
Ich kehre von jeder schweifenden Betrachtung zurück und sehe die Felsen selbst an, deren Gegenwart meine Seele erhebt und sicher macht. Ich sehe ihre Masse von verworrenen Rissen durchschnitten, hier gerade, dort gelehnt in die Höhe stehen, bald scharf übereinander gebaut, bald in unförmlichen Klumpen wie übereinander geworfen, und fast möchte ich bei dem ersten Anblicke ausrufen: Hier ist nichts in seiner ersten, alten Lage, hier ist alles Trümmer, Unordnung und Zerstörung. Ebendiese Meinung werden wir finden, wenn wir von dem lebendigen Anschauen dieser Gebirge uns in die Studierstube zurückeziehen und die Bücher unserer Vorfahren aufschlagen. Hier heißt es bald, das Urgebirge sei durchaus ganz, als wenn es aus einem Stücke gegossen wäre, bald, es sei durch Flözklüfte in Lager und Bänke getrennt, die durch eine große Anzahl Gänge nach allen Richtungen durchschnitten werden, bald, es sei dieses Gestein keine Schichten, sondern in ganzen Massen, die ohne das geringste Regelmäßige abwechselnd getrennt seien, ein anderer Beobachter will dagegen bald starke Schichten, bald wieder Verwirrung angetroffen haben. Wie vereinigen wir alle diese Widersprüche und finden einen Leitfaden zu ferneren Beobachtungen? (13/257)
Ebenso wie die Rede des Schaustellers den Ort der Rede abbildet,
spiegeln die Meinungen der Gelehrten über den Granit dessen
scheinbares Ansehen von Trümmer, Unordnung und
Zerstörung
wider. Ja der Gedankgengang entwickelt sich hier
wie dort nach einer Logik
, die sich selbst aufhebt: der
intuitiven Sicherheit des Beginns widerspricht das Chaos der
Felstrümmer; die erste Meinung
, die dann zur
Bestätigung herangezogen wird, behauptet aber
überraschenderweise analog zur ersten These, das Urgebirge sei
durchaus ganz, als wenn es aus einem Stücke gegossen
wäre
, und im Fortgang zeigt sich schließlich, daß
das Chaos der gelehrten Schriften weniger im Urgebirge als im Chaos der
Meinungen liegt.
Es scheint sich hier um eine für Goethes naturwissenschaftliches Denken typische Bewegung zu handeln. Das Objekt wird zunächst in seiner Totalität synthetisch aufgefaßt, sodann die Gegenposition bedacht, die jeden Zusammenhang bestreitet. So wird es in seiner vollen Gegensätzlichkeit anerkannt; der Schluß verschiebt den Widerstreit jedoch vom Gegenstand auf das denkende Subjekt, das auf diese Weise mit seinem Gegenstand identifiziert wird, sich gewissermaßen in ihn auflöst. So wird dem Gegenstand keine Gewalt angetan, denn seine Ambivalenz bleibt gewahrt, und dennoch behält die These der Totalität recht. Im gleichen Zuge wird die Differenz von Subjekt und Objekt ausgehebelt, der Betrachter als Teil und Resultat des Betrachteten in dieses einbezogen.
Der Schluß
vom Widerstreit der Meinungen auf den
Betrachter ist in der Rede des Schaustellers weniger offensichtlich.
Dennoch weisen seine Redeteile jeweils in diese Richtung, wenn am Ende
jeden Beispiels der Mensch eingeführt wird, und zwar in
aufstrebender Reihenfolge von der Abhebung von der Natur hin zum
Aufstieg zum Göttlichen: als Riesen und Zwerge, Mann und Frau,
Daniel. Genauer besehen unterliegen sowohl jeder Redeteil für sich
als auch die Redeteile untereinander dem Gesetz von Polarität und
Steigerung: Das erste Drittel thematisiert die mineralische Welt in
Polarität und Steigerung bis zu den ungestalten, polaren
Übergangswesen Riesen und Zwergen; das zweite Drittel setzt bei
der unteren Tierwelt an und endet beim Menschen. Mit Mann und Frau wird
auch dessen Polarität hervorgehoben. Das letzte Drittel beginnt
mit der oberen Tierwelt und endet beim Menschen, der seine Einheit
(keine Doppelung!) in der weiteren Steigerung zum frommen Gesang
findet. [Vgl. Abb.1: Polarität und Steigerung in der Rede des
Schaustellers] Trotz der klaren Struktur tritt in der Zurücknahme
des Ziels der Denkbewegung auf eine bloße Andeutung das Un- oder
Widerlogische der Rede in den Vordergrund. Die Auflösung der
Frage, wie das Trümmerfeld als Totalität aufgefaßt oder
doch in eine solche integriert werden könne, wird damit auf
später verschoben. Wir bleiben vorläufig auf dem Standpunkt
der Polarität
, werden aber schon auf die kommende
Steigerung
verwiesen, deren Notwendigkeit Goethe auch im
Gespräch mit Eckermann hervorhebt.26
Die Schaustellerrede deutet ein Resultat nur an, ohne es zu erreichen. Damit entspricht sie dem Standpunkt, auf dem sie gehalten wird: dem Grenzbezirk des Trümmerfeldes.
6. Der Burghof
Es soll hier nicht Goethes geologisches Denken entfaltet werden. Wir
benutzen die Schrift Über den Granit
nur soweit, als es zum
Verständnis der Novelle
notwendig scheint.
Wie überall war Goethe auch in seiner geologischen Forschung an
Kontinuität interessiert: methodisch in dem Bestreben,
möglichst vollständige Reihen von Varietäten zu
beobachten und zu deuten; chronologisch in der Abneigung gegen die vom
Vulkanismus vertretenen erdgeschichtlichen Revolutionen; und
schließlich fühlte er sich durch Beobachtungen während
der Harzreisen auch in der Auffassung räumlicher Kontinuität
bestätigt. Der Granit erscheint ihm als die Grundfeste unserer
Erde [...], worauf sich alle übrigen mannigfaltigen Gebirge
heraufgebildet.
(13/254) Vom Erdinnern her bildet der Granit daher
ein einziges Kontinuum bis zu den höchsten Gipfeln, die
unerschütterlich auf diesem Grund stehen. Alle Erschütterung,
alle Unordnung, selbst Vulkane entstehen nur als Epiphänomene der
Erosion an der Oberfläche, ohne die Substanz der Erde zu
berühren.27
Der Weg der Zerstörung führt also immer von oben nach unten; die Täler mit ihren Flußläufen — und zuletzt die Ozeane — bilden Sammelbecken von Trümmern (Sedimente), während die ursprünglichen Gipfel zwar nach und nach abgetragen werden, aber jederzeit frei von Trümmern und in direkter Verbindung mit ihrem Grund bleiben. Überraschend die Schlußfolgerungen:
Mit diesen Gesinnungen nähere ich mich euch, ihr ältesten, würdigsten Denkmäler der Zeit. Auf einem hohen nackten Gipfel sitzend und eine weite Gegend überschauend, kann ich mir sagen: Hier ruhst du unmittelbar auf einem Grunde, der bis zu den tiefsten Orten der Erde hinreicht, keine neuere Schicht, keine aufgehäufte zusammengeschwemmte Trümmer haben sich zwischen dich und den festen Boden der Urwelt gelegt, du gehst nicht wie in jenen fruchtbaren schönen Tälern über ein anhaltendes Grab, diese Gipfel haben nichts Lebendiges erzeugt und nichts Lebendiges verschlungen, sie sind vor allem Leben und über alles Leben. (13/255)
Das Leben und mit ihm der Tod, alles was die Menschen bewegt, die als
Bewohner jener fruchtbaren quellreichen Ebnen, die auf dem Schutte
und Trümmern von Irrtümern und Meinungen ihre
glücklichen Wohnungen aufgeschlagen haben, den Staub ihrer
Voreltern aufkratzen und das geringe Bedürfnis ihrer Tage in einem
engen Kreise ruhig befriedigen
, (13/256) ist Produkt der Erosion
des Urgebirges, während dieses selbst von seinen Abfallprodukten
gänzlich unberührt, 'rein' bleibt.28 Die
Gegensätze zwischen Leben und Tod, Glück und Unglück,
schön und häßlich betreffen nicht eine statische
Ordnung, die über ihnen steht. Sie lassen sich nur ertragen,
solange die Perspektive begrenzt bleibt — wie es allerdings im
Tale natürlich ist — und daher die Relativität oder gar
Nichtigkeit des menschlichen Lebens nicht in den Blick kommt. Auf dem
Gipfel dagegen, auf dem diese Betrachtungen angestellt werden,
entwickelt sich das Gefühl des Erhabenen29 und eine
Sehnsucht nach dem nähern Himmel
. (13/256) Umgekehrt fehlt
aber auch hier oben das Glück, das sich aus der Befriedigung
begrenzter Bedürfnisse ergibt.
Der Burghof der Novelle
ist offensichtlich in Analogie zu dem
Gipfel in Über den Granit
angelegt. Er besteht aus einem
Felsen von den festesten des ganzen Gebirgs
(493); er zeigt sich
dem Blick der Fürstin durch das Fernrohr über Busch, Berg
und Waldgipfel
(492); er stellt sich wie der Gipfel des
geologischen Aufsatzes als flacher Felsgipfel von der Natur
geplättet
(494) dar. Die Burg jedoch, die sich auf dem Gipfel
erhebt und bislang zumeist als gelungene Einheit von Natur und Kunst
interpretiert wurde, widerspricht der in dem Aufsatz skizzierten
Ordnung, indem sie die natürliche Ordnung verdeckt. Denn um diese
sichtbar zu machen, muß der Gipfel nackt
bleiben, auf dem
Felsen der Novelle
aber steht gemauert ein Turm, doch niemand
wüßte zu sagen, wo die Natur aufhört, Kunst und
Handwerk aber anfangen.
(493). Der Ort der Stammburg entspricht
damit den rohen Zeiten, in denen sie angelegt wurde: Es ging den
Vorfahren des Fürsten um Herrschaft nicht nur über die im Tal
situierte Gesellschaft, sondern ebenso über die Natur. Die Burg
stellt, aus Bruchstücken oder Trümmern des Urgebirges
aufgemauert, die natürliche Ordnung auf den Kopf: der oberste
Punkt steht nicht mehr im kontinuierlichen Zusammenhang mit den
Grundfesten der Erde. Den sichtbaren Ausdruck dafür bildet der
Ahorn, der
auf den Stufen, die in den Hauptturm hinaufführen, [...] Wurzel geschlagen und sich zu einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Not daran vorbeidringen kann, um die Zinne, der unbegrenzten Aussicht wegen, zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten, denn dieser Baum ist es, der sich weit über das Ganze wunderbar hoch in die Luft erhebt. (494)
Mit der Anlage der Burg erst entstand wie im Tal die Möglichkeit
des Bewuchses. So wächst auf den Treppenstufen — die ja aus
Felsstücken gebaut wurden und somit Fugen aufweisen — der
Ahorn und verwandelt den ursprünglich erhabenen Gipfel in eine
bequeme Idylle. Daran anschließend bedarf es nicht viel, wie der
Oheim sagt, um jeden Wanderer, jeden Besuchenden in Erstaunen zu
setzen, zu entzücken.
(493) Das Erhabene wird in ein
Schönes umgedeutet und damit ein Verständnis der Ordnung der
Natur nahezu unmöglich. Der Oheim, der Fürst, die
Fürstin — all jene, die an der Umdeutung des Erhabenen in
ein Schönes Interesse zeigten, werden daher von dem
abschließenden Spiel im Burghof ausgeschlossen und ziehen wieder
abwärts, zu Stadt und Schloß. Für das Folgende kommen
sie nicht weiter in Betracht. Eine Ausnahme bildet nur Honorio. Dies
mag, wie sein oft erörterter Blick gen Westen, in die untergehende
Sonne und nach Amerika, als Andeutung der Entsagung aufgefaßt
werden.
7. Theater
Nachdem die Stammburg als ein der Ordnung der Natur entgegenstehendes
Element ausgemacht worden ist, scheint es nicht recht einsichtig, warum
die Novelle
gerade dort, im Burghof, abschließt. Das
scheint auf eine Bestätigung der Intentionen der Vorfahren zu
deuten. Es ist jedoch zu bedenken, daß die feudalen Vorfahren des
Fürsten die Burg als Herrschaftsinstrument benutzten und sich
dergestalt die Verkehrung der Ordnung auf Dauer zunutze zu machen
suchten (und scheiterten), während die Vorstellung von Kind und
Löwe — ebenso wie der Aufenthalt des Betrachters in
Über den Granit
— nur ein transitorisches Moment
darstellt: letzterem ruft die brennende Sonne Durst und Hunger,
seine menschlichen Bedürfnisse, zurück
(13/256), und in
der Novelle
wird, wie Goethe gegenüber Eckermann
feststellt, der Schausteller sehr bald mit dem eisernen Käfig
aus der Stadt da sein und den Löwen darin
zurückführen.
30 In beiden Fällen folgt auf
die Erhebung der Abstieg, die Rückkehr in menschliche Bezirke und
die Integration der gewonnenen Einsicht in das Leben im Tal.
Es kommt also darauf an, das Erhabene mit dem wechselhaften, dem Tod
ausgelieferten Leben im Tal zu vermitteln. In der Novelle
werden
zwei Wege der Vermittlung vorgestellt: einmal der Weg des
Fürst-Oheims, der die Stammburg in Zeichnungen festhalten
läßt, um später den Gartensaal damit zu zieren
.
(495) Das Erhabene wird damit zwar auf Dauer in der künstlerischen
Repräsentation ansichtig, aber zugleich auf die Höhe des
Schlosses, der Gegenwart, des wechselhaften Lebens und des Ornaments
herabgezogen und damit seines Charakters entkleidet. Den umgekehrten
Weg geht die Novelle
insgesamt: das menschliche Leben wird zum
Erhabenen hinaufgezogen, aber nicht wie beim Bau der Stammburg auf
Dauer gestellt, sondern bloß transitorisch, als Theaterspiel. Als
symbolisches Spiel wird das Erhabene in das Leben integrierbar —
aber auch nur als solches: ist doch schon der Versuch der Vorfahren,
sich des Erhabenen auf Dauer zu bemächtigen, gescheitert.
Daß es sich bei der 'Zähmung' des Löwen durch das Kind
um Theater auch im abschätzigen Sinne des Wortes handelt, ist
unlängst hervorgehoben worden.31 Es ist wohl anzunehmen,
daß sie Teil der üblichen Vorführungen auf dem
Marktplatz und somit Routine ist. Schon der Fürst-Oheim hatte
angesichts der grellen Bemalung der Bretterbude gesagt: Drinnen
liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier muß er
grimmig auf einen Mohren losfahren, damit man glaube, dergleichen
inwendig ebenfalls zu sehen
. (498) Eine weitere Assoziation zum
Theater entsteht durch die Identifikation des Knaben mit Pan, dem
Begleiter des Theater-Gottes Dionysos. Auch deutet der Kommentar des
Erzählers zu der Szene des Dornausziehens, daß die Mutter
sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht
angewohnterweise [!] Beifall gerufen und geklatscht hätte,
wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels
erinnert worden, daß die Gefahr nicht vorüber sei
(512),
in diese Richtung. Vor allem aber ist es der Bau selbst, der an das
(antike) Theater erinnert: Der zusammengestürzte Torturm, seit
undenklichen Jahren von niemand betreten
(494), bildet die Skene.
Der Wärtel führt Mutter und Kind zunächst durch einen
beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade dem Eingang
gegenüber
(511). Mutter und Wärtel schauen, wie Honorio,
der auf einem abgelegeneneren Mauerstück sitzt, von diesem Koilon
(der antiken Zuschauertribüne) aus dem Geschehen zu, während
das Kind hinabsteigen [mag], gleichsam in die Arena des
Schauspiels
(511). Da der Haupteingang durch den Turm
unzugänglich ist, hat man ihm von der Seite beizukommen
(494) versucht, also einen Zugang geschaffen, dessen Lage dem Parados
im antiken Theaterbau entspricht. Dort liegt der Löwe und wird von
dem Knaben für den gemeinsamen 'Auftritt' auf der Orchestra
abgeholt. Durch eine der kleinen Wendeltreppen, die er in der Ecke
sieht
(511), soll das Kind den Spielplatz schließlich
verlassen. Sie entsprechen den Treppen, die seitlich zu den Koiloi
hinaufführen.32
Die Inszenierung der Löwenbändigung setzt die Umgestaltung
der Burganlage durch den Oheim voraus. Der mittelalterliche Bau wurde
durch den Torturm betreten, der damit noch nicht die Funktion der zur
Orchestra hin abgeschlossenen Skene übernahm. Zum
Aufführungsort wird der Platz erst über mehrere historische
Stufen: Anlage der Burg im Mittelalter, anschließender Verfall
besonders des Torturmes und schließlich die parkartige
Umgestaltung mit dem neuen, seitlichen Zugang sowie das Entweichen des
Löwen. Wenn das Kind schließlich ein friedliches Miteinander
von Mensch und Tier, Natur und Kultur inszeniert, so setzt das deren
vorherige Trennung voraus. In der Geschichte der Burg schlägt sich
die Geschichte des Auseinanderdriftens von Mensch und Natur wie in
einem Kondensat nieder, und hier wird das Getrennte symbolisch wieder
vereint. Der Burghof spielt jedoch nicht nur auf das antike Theater an;
er bezieht sich ebenfalls auf Daniel in der Löwengrube, von dem
das Kind in seinem Lied singt. Wie wir oben sahen, bildet Daniel den
Höhepunkt der noch dem Polaritätsschema folgenden Rede des
Schaustellers. Genau hier knüpft das Kind an. Hatte die Rede des
Schaustellers die Regeln der Logik schon durch sukzessive Verschiebung
der Inhalte verletzt, so erstrebt das Lied des Kindes überhaupt
nicht mehr, einen angebbaren Zusammenhang herzustellen. Das
'Ineinanderschieben' selbst wird zum bestimmenden Moment, wie der
Erzähler hervorhebt: Eindringlich aber ganz besonders war,
daß das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung
durcheinander schob und dadurch, wo nicht einen neuen Sinn
hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich selbst aufregend
erhöhte.
(508) Es ist dies bloß noch ein Spiel mit
Inhalten, die als Gegenstände dadurch zwar nicht verdrängt,
aber ihrer Gegenständlichkeit entkleidet werden. Man möchte
das Verfahren mit einem Zitat Kants illustrieren. In der Kritik der
Urteilskraft
wird die Produktion von ästhetischen Ideen als
Vermögen des Genies bestimmt. Kant versteht darunter diejenige
Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlaßt,
ohne daß ihr doch irgend ein bestimmter Gedanke, d.i. Begriff
adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht
und verständlich machen kann.
33 Die
Verwandtschaft zu Goethes bekannter Bestimmung des Symbols im Gegensatz
zur Allegorie liegt auf der Hand.34 Wichtig ist aber das Verfahren
des Verschiebens, mittels dessen hier ästhetische Ideen produziert
werden. Im Lied des Knaben verselbständigt sich dieses Verfahren
derart, daß ein Begriff auch entfernt nicht mehr auszumachen ist.
Es handelt sich bei dem Lied, könnte man annehmen, um reine Kunst.
'Reine Kunst' bedeutet nicht: inhaltslose Kunst. Ihre Inhalte stehen durch die Verschiebung nicht mehr in einem angebbaren Zusammenhang und können daher nicht auf den Begriff gebracht werden, sind aber doch vorhanden und eröffnen einen Assoziationsraum35, den es abzutasten gilt.
8. Verschiebungen
Nun schieben sich in dem Liede die Situation Daniels in der
Löwengrube und des Kindes im Burghof ineinander; in den Zeilen
Aus den Gruben, hier im Graben / Hör ich des Propheten Sang; /
Engel schweben, ihn zu laben, / Wäre da dem Guten bang?
(508)
ist der Gegenstand der Rede insbesondere durch das deiktische
hier
nicht mehr auszumachen. Daniel und das Kind fließen
in eins. Der Sang
ist nicht nur Daniels, sondern auch das Lied
des Kindes, die Engel schweben, Daniel und den Knaben
gleichermaßen zu schützen. Die biblische Situation in der
Grube wiederholt sich in dem grubenartigen Burghof. Eine zweite
biblische Anspielung ist zu beachten. Schon vor längerer Zeit
wurde diskutiert, ob die Zeile Blankes Schwert erstarrt im Hiebe
(509) auf die Opferung Isaaks auf dem Berge Morija verweist. Wir
möchten gegen Brummack36 diese Auffassung vertreten, denn
das Ineinanderblenden der Opferstellen 'in der Grube' (Daniel) und 'auf
dem Gipfel' (Isaak) bildet die letzte Szene der Novelle
genau
ab. Zudem erscheint das Opfer auf dem Gipfel auch in Über den
Granit
: Hier auf dem ältesten, ewigen Altare, der
unmittelbar auf die Tiefe der Schöpfung gebaut ist, bring ich dem
Wesen aller Wesen ein Opfer.
(13/256) Es ist dies zwar nur ein
symbolisches, das Opfer der Kunst, nichtsdestotrotz aber wie im Falle
des erlassenen Opfers Isaaks und Daniels auch hier ein Menschenopfer,
das erlassen wird.37 Und hier werden wir auf ein weiteres
'Ineinanderschieben' aufmerksam: nicht weit von der Grube, dem Graben
liegt die Assoziation 'Grab'. Tatsächlich genügt es, nur den
letzten Buchstaben der ersten Zeile auszulassen, um das Lied in das
Lied eines Toten, eines (erlassenen) Menschenopfers eben, zu
verwandeln: Aus den Gruben, hier im Grabe
! Auch das Wort 'Grube'
erhält ein neues Ansehen, verwendet Goethe es doch häufig in
der Bedeutung von 'in die Grube fahren'.38
Der Verflechtung des Erhabenen ins Vergängliche, des Lebens in den
Tod im symbolischen Spiel schließt sich ein weiteres 'Ineinander'
an. Wenn die zweite Hälfte der letzten Strophe grammatisch so
komplex wird, daß sie sich erst bei zweiter oder dritter
Lektüre erschließt und als verborgene 'Quintessenz' der
Novelle
sich gewissermaßen aufdrängt (und von den
Interpreten auch so verstanden worden ist39), so
steht dem die Trivialität ihres Inhalts entgegen. Denn das
Knie
, an das der Löwe durch frommen Sinn und Melodie
gebannt wird, möchte man vielleicht als den profansten aller
Körperteile ansprechen. Liebem Sohn ans zarte Knie
! Das
Lächerliche der Formulierung springt demjenigen sofort in die
Augen, der sich nicht durch blinde Goetheverehrung die Sicht auf den
Text hat vernebeln lassen. So schieben sich zum Schluß der
Novelle
das Tief-Symbolische
und das einfach
Lächerliche ineinander, das dicht Gedrängte komplexester
Poesie und die Flachheit eines Witzes, das Erhabene der Tragödie
und das Komische des Lustspiels. Und um Komödie, um Zirkus
handelt es sich ja schließlich auch bei der Zähmung des
Löwen.
Ein letztes 'Durcheinanderschieben' ist zu bemerken. Das Ineinander von
Tal und Gipfel, Grube und Grab, Daniel und Isaak bezog sich auf
Inhalte; mit dem Lied des Knaben kommen jedoch im Reim auch
Lautverschiebungen zum Tragen. Damit ist eine weitere Steigerung
erreicht, denn die logische Beziehung von Inhalten wird nicht mehr nur
durch deren Verschiebung gelöscht, sondern die (Laut-)
Verschiebung wird im Reim zum formalen Prinzip der Rede. Von diesem
Formgesetz wird jedoch rückgreifend, wie zuletzt festzustellen
ist, der gesamte Text einschließlich seiner Prosateile
umfaßt. Gemeint ist der verslose Reim: Sporn — Dorn. Der
Sporn des Reiters
(491), der zu Beginn der Novelle
die
Pferde zur bevorstehenden Jagd anfeuert, wird ihnen in das Fleisch
getrieben. Den Dorn
jedoch zieht das Kind zum Schluß dem
Löwen aus dem Ballen. In der Lautverschiebung von Sporn
auf
Dorn
ist die gesamte Entwicklung der Novelle
aufgehoben:
vom Menschen, der mit seinen Produkten die Natur verletzt (Sporn als
Kunstprodukt, Jagd, Burg, Eindringen in Arkadien) führt sie zum
Menschen, der sie, ohne ihr Gewalt anzutun, im bloßen
symbolischen wieder Spiel heilt (Dorn als Naturprodukt). Daß auch
die gesamte Novelle
wie die Schlußszene als Theaterspiel
zu verstehen ist, zeigt sich zuletzt in der Verwendung des Schleiers.
Zu Beginn hebt sich ein dichter Herbstnebel
(491) wie der
Theatervorhang. Diesem sich lichtenden Schleier
(491) entspricht
gegen Ende der Novelle
das Halstuch, mit dem der Knabe die Wunde
des Löwen verbindet. Es wurde schon anderwärts40 als die
Goethesche Dichtungs-Metapher 'Schleier' erkannt. Sie legt sich hier um
die offene Wunde der Natur, die vom Menschen in der Dichtung symbolisch
geheilt wird:
Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere Vordertatze auf den Schoß gehoben, die der Knabe fortsingend anmutig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein scharfer Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgfältig zog er die verletzende Spitze hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuch vom Nacken und verband die greuliche Tatze des Untiers, sodaß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnterweise Beifall gerufen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gefahr nicht vorüber sei. (512)
'Vorhang auf!' zu einem Spiel, das den Menschen als die Natur
verletzendes Wesen zeigt; mit 'Vorhang zu, Applaus'! schließt die
Novelle
zu einem guten, beruhigenden Ende. Im Spiel der Kunst
werden die Wunden wieder geheilt, die der Mensch der Natur
schlägt. Vor übereilten Schlußfolgerungen ist jedoch zu
warnen. Die Natur wird nur 'im Spiel' geheilt; die Burg wird, mit oder
ohne Umgestaltung durch den Oheim, weiter verfallen, der Felsen mit der
Zeit wieder nackt werden. Die Bewohner jener fruchtbareren
quellreichen Ebnen
werden weiterhin auf dem Schutte und
Trümmern von Irrtümern und Meinungen ihre glücklichen
Wohnungen
(13/256) aufschlagen. Auf beiden, der Natur wie den
Irrtümern der Menschen, als Voraussetzung aber baut die Kunst ein
Neues, das Goethe im Gespräch mit Eckermann als Blume
(gemeint ist die Blüte) kennzeichnet:
Um für den Gang dieser Novelle ein Gleichnis zu haben, fuhr Goethe fort,so denken Sie sich aus der Wurzel hervorschießend ein grünes Gewächs, das eine Weile aus einem starken Stengel kräftige grüne Blätter nach den Seiten austreibt und zuletzt mit einer Blume endet. Die Blume war unerwartet, überraschend, aber sie mußte kommen; ja das grüne Blätterwerk war nur für sie da und wäre ohne sie nicht der Mühe wert gewesen.41
Um im Bild zu bleiben: Die Novelle
wurde bislang so verstanden,
als ob sich nachträglich das gesamte Gewächs zur Blüte
umbilden würde: die Natur verschönert, der Brand
gelöscht, das Fürstentum zu Schillers ästhetischem Staat
umgebildet. Davon kann jedoch keine Rede sein. Die Blume, das
inszenierte Spiel im Burghof, besteht nach ihren eigenen Gesetzen (die
wir als Löschung des Begriffs durch Verschiebung der Inhalte
bestimmt haben). Die zu Beginn der Erzählung ausgelegten
Fäden werden nicht etwa deswegen nicht wieder aufgenommen, weil
alle Fragen gelöst sind, sondern weil das Schicksal von Stadt und
Fürstenfamilie für die Kunst gleichgültig ist, die auf
ihnen als Voraussetzung aufbaut: es wäre eben nicht der
Mühe wert gewesen
, weiter darüber zu berichten.42
Anmerkungen
1 So
Eckermann. Goethe verzeichnet dagegen im Tagebuch Gespräche mit
Eckermann über die Novelle
für den 24. und 25. Januar.
2 Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Hrsg. v. Fritz Bergemann. Frankfurt: Insel 1981, Bd. 1, S. 195f (18. Januar 1827).
3 Goethe,
Novelle. In: Hamburger Ausgabe (HA), Bd. 6. München: DTV 1982, S.
500. Auf diese Ausgabe beziehen sich im folgenden die Nachweise im Text
mit Band- und Seitenangabe. Zitate ohne Bandangabe beziehen sich auf
die Novelle
.
4 Vgl. dazu
Goethe, Die Wahlverwandtschaften
I/4 und I/15. HA, Bd. 6, S.
266ff und 335ff.
5 Emil Staiger, Goethe: Novelle. In: Interpretationen. Hrsg. v. Jost Schillemeit. Bd. 4: Deutsche Erzählungen von Wieland bis Kafka. Frankfurt: Fischer Tb 1966, S. 53-74. Zuerst in: Trivium 1, 1942, S. 4-30.
6 Vgl. z.B.
Dieter Borchmeyer, Goethes Novelle
und die Idee des Friedens.
In: D.B., Höfische Gesellschaft und französische Revolution
bei Goethe. Adliges und bürgerliches Wertsystem im Urteil der
Weimarer Klassik, Kronberg/Ts.: Athenäum 1977, S. 333-350 oder
Jürgen Jacobs, Löwen sollen Lämmer werden
. Zu
Goethes Novelle
. In: Literarische Utopie-Entwurfe. Hrsg. v.
Hiltrud Gnüg, Frankfurt: Suhrkamp 1982, S. 187-195 und zuletzt,
wenn auch relativiert: Regine Otto, Johann Wolfgang Goethe:
Novelle
. In: Deutsche Erzählungen der frühen
Restaurationszeit. Studien zu ausgewählten Texten. Hrsg. v. Bernd
Leistner, Tübingen 1995, S. 26-65, bes. S. 58ff.
7 Staiger, Novelle, S. 59.
8 Borchmeyer,
S. 341. In demselben Sinne etwa Friedrich Strack, Goethes
Novelle
und Schillers Idylle. Zwei Wege ästhetischer
Versöhnung. In: Euphorion 77, 1983, S. 438-452, hier S. 443, oder
Helmut Merkl, Gratisvorstellung im Burghof. Zur Deutung von Goethes
Novelle
. In: ZDPh 116, 1997, S. 209-223, hier bes. S. 217-219.
Leider übernimmt auch Hanno Möbius in seinem sonst
interessanten und thematisch mit dem vorliegenden verwandten Aufsatz
diese Auffassung und kommt daher zu verkürzten
Schlußfolgerungen. Vgl. H.M., Die Schlußzene der
Novelle
. Goethes Beitrag zum literarischen Tableau. In: LiLi,
Jg. 27, 1997, S. 118-129, hier S. 127f. — Die bis zum
Überdruß wiederholte und von Merkl erneut ausführlich
begründete Feststellung, daß der Tiger zahm sei, ist zwar
richtig, ebenso richtig ist aber auch, daß Honorio dies noch
nicht wissen kann, als der Tiger auftaucht. Er mag daher zwar
irrtümlich, vielleicht auch aus anachronistischen Vorstellungen
heraus gehandelt haben und nach dieser Einsicht seine veraltete
Vorstellung von Rittertum aufgeben; daß er falsch gehandelt oder
gar einen Frevel
begangen habe, wird man jedoch kaum behaupten
können.
9 Gelegentlich
überrascht die Sicherheit, mit der unbelegte Behauptungen
vorgetragen werden. So heißt es bei Johannes Endres, Unerreichbar
nah. Zur Bedeutung der Goetheschen Novelle
für Stifters
Erzählkunst. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft XLI,
1997, S. 256-294, Anm. 112: Aus gegebenem Anlaß sei das
eigentlich Selbstverständliche noch einmal betont: Von vornherein
zahm ist der Tiger, der Löwe hingegen muß durch die
Anstalten des Knaben erst gezähmt werden — welche Differenz
bei Jürgen Brummack [folgt Nachweis] und bei G. Kaiser [Nachweis]
offenbar verkannt wird. Die übereinstimmende Behauptung der
Interpreten, daß auch der Löwe 'längst' / 'schon' zahm
gewesen sei, verfehlt eindeutig Goethes Intention, reproduziert dagegen
eine (gewollte) Sinnverkürzung G. Benns.
Warum Goethes
'Intention' von Brummack und Kaiser verfehlt wird und auf welche Weise
sie eindeutig festzustellen sei, wird nicht erläutert, wohl aber
der Hinweis des Schaustellers in der Novelle
übersehen,
daß sich ein Bauer ohne Not
(505) vor dem Löwen auf
einen Baum gerettet habe. Weitere Hinweise darauf, daß auch der
Löwe zahm ist, folgen unten.
10 Vgl. auch Herman Meyer, Raumgestaltung und Raumsymbolik in der Erzählkunst. In: H.M., Zarte Empirie, Stuttgart 1963, S. 33-56, sowie Möbius.
11
Während des Lesens hatte ich die außerordentliche
Deutlichkeit zu bewundern, womit alle Gegenstände bis auf die
kleinste Lokalitat vor die Augen gebracht waren.
Eckermann, Bd. 1,
S. 186 (15. Januar 1827).
12 Nicht so
leicht allerdings, als daß sich bei den Interpreten nicht
gelegentlich Verwirrung über die Anlage des Raumes eingestellt
hätte. So verlegt etwa Anneliese Klingenberg, Goethes
Novelle
und Faust II
. Zur Problematik Goethescher
Symbolik im Spätwerk. In: Impulse 10, 1987, S. 75-124, hier S. 85,
das unerhörte Ereignis
der Löwenbesänftigung in
den Hohlweg, der zur Burg hinaufführt. Otto, Anm. 40,
mißversteht Klingenberg und spricht nun von der Entscheidung
des Fürsten im Hohlweg
, obwohl er den Weg gar nicht betritt.
Möbius, S. 121, wiederum meint, daß die Burg
topographisch somit ein Kreuz
bildet — eine Behauptung,
für die wir im Text keine Belege finden.
13 Vgl.
meinen Aufsatz: Bauen, Erhalten,
Zerstören, Versiegeln. Architektur als Kunst in Goethes
Wahlverwandtschaften
. In: Zeitschrift für Deutsche
Philologie, Bd. 118, 1999, S. 500-517 [PDF]
14 So
Herbert Lehnert entgegen der herrschenden Auffassung: H.L., Tensions in
Goethe's Novelle
. In: Goethe's Narrative Fiction. The Irvine
Symposium. Ed. By William J. Lillyman. Berlin 1983, S. 176-192, hier
bes. S. 186.
15 Der
Grund für die unterschiedlichen Richtungen dürfte
wahrscheinlich darin zu suchen sein, daß die Novelle
im
Wesentlichen die politische Geschichte thematisiert, während die
Wahlverwandtschaften
gewissermaßen die Geschichte der
modernen Subjektivität schreiben. Sie entwickelt sich aus der
Natur (Mühle) über die Religion (Kirche) und die
Aufklärung (Schloß) zur romantischen, scheinbar
selbstbestimmten Subjektivität (Lustgebäude). Beide Varianten
sind mit Goethes Auffassung der Erdgeschichte vereinbar, derzufolge
bekanntlich der Granit als das älteste Gestein sowohl die Basis
als den Gipfel der Gebirge bildet. Vgl. auch weiter unten.
16 Borchmeyer, S. 345. Vgl. z.B. auch Klingenberg, S. 87.
17 Als ein
Beispiel für viele sei hier nur Otto, S. 39 zitiert: Als
Metapher für die Gewaltbereitschaft des menschlichen Wesens dient
in der
Novelle
die Jagd.
18 So auch
Otto, S. 46. Seltsamerweise stellt sie aber das in der Novelle
benutzte Fernrohr in einen Gegensatz zu Goethes bekannter Abneigung
gegen Sehhilfen
.
19 23. August 1804 aus Rom. Goethe teilt den Schreiber allerdings nicht mit und hat den Wortlaut seinen Bedürfnissen entsprechend verändert. Das Original findet sich in: Wilhelm von Humboldt, Werke, Bd. V. Hrsg. v. Andreas Flitner und Klaus Giel, Darmstadt: Wiss. Buchges. 1981, S. 212-221.
20 Vgl. z.B. Otto, S. 52 und Klingenberg, S. 89.
21 Wenn man
Goethes Motto zur Italienischen Reise: Auch ich in Arkadien!
,
das für gewöhnlich auf Rom bezogen wird, mit der zitierten
Briefstelle von Humboldt zusammenhält, ergibt sich eine
auffällig mit der Novelle
übereinstimmende Struktur:
Arkadien, im Innern chaotisch, umgeben von einer Wüstenei.
22 So
Herman Meyer, Natürlicher Enthusiasmus. Das Morgenländische
in Goethes Novelle
. Heidelberg: Stiehm 1973, S. 29. Meyer geht
es hier aber ausschließlich um den Übergang vom gesprochenen
Wort zur Musik.- Klingenberg bezieht die Novelle
dagegen auf den
ersten Akt von Faust II
.
23 In den autobiographischen Schriften wird der Ahorn nur gelegentlich und nicht an prominenter Stelle erwähnt. Ausführlich wird sein Holz als das beste Material fur Bögen in dem Gespräch mit Eckermann vom 1. Mai 1825 besprochen (Vgl. Eckermann, Bd. II, S. 538-553). Von daher könnte er auch als ein weiterer Hinweis auf den kriegerischen Charakter der Burg verstanden werden.
24 Vgl.
Faust, V. 9870f, Euphorion: Nein, nicht ein Kind bin ich erschienen,
/ In Waffen kommt der Jüngling an
.
25 Vgl. V.
9883: Ist der holde Bund ein Traum?
26 Vgl. den
letzten Abschnitt des Zitats
oben sowie Goethes Erläuterung dieser Begriffe in seinem
Schreiben an Kanzler von Müller über den Aufsatz Die
Natur
, 24. Mai 1828: Die Erfüllung aber, die ihm [dem
Aufsatz] fehlt, ist die Anschauung der großen Triebräder
aller Natur: der Begriff von Polarität und Steigerung, jene der
Materie, insofern wir sie materiell, diese ihr dagegen, insofern wir
sie geistig denken, angehörig; jene ist in immerwährendem
Anziehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aufsteigen.
[...]
(13/48).
27 In
der Ferne heben sich tobende Vulkane in die Höhe, sie scheinen der
Welt den Untergang zu drohen, jedoch unerschüttert bleibt die
Grundfeste, auf der ich noch sicher ruhe, indes die Bewohner der fernen
Ufer und Inseln unter dem untreuen Boden begraben werden.
(13/256f)
28 Noch
prägnanter stellt sich die Auffassung des Lebens als Resultat von
Abfallprodukten des Urgebirges bei Tieck dar. Im Runenberg heißt
es: [...] in den Pflanzen, Kräutern, Blumen und Bäumen
regt und bewegt sich schmerzhaft nur eine große Wunde, sie sind
der Leichnam vormaliger herrlicher Steinwelten, sie bieten unserm Auge
die schrecklichste Verwesung dar.
Ludwig Tieck, Werke in vier Bdn.,
Bd. II: Die Märchen aus dem Phantasus. Dramen. Hrsg. v. M.
Thalmann, München 1964, S. 77. Vgl. dazu auch meinen Aufsatz: Der Textanfang als kosmologischer
Entwurf: die Motive des Musenanrufs und des Waldes. In: Euphorion
87, 1993, S. 420-437, zu Tieck S. 426-429. — Für Tiecks
Naturauffassung spielen G.H. Schubert und Schellings Naturphilosophie
eine größere Rolle; inwiefern Goethe diese oder auch Tieck
direkt beeinflußt hat, bliebe zu klären.
29 Ich
fühle die ersten, festesten Anfänge unsers Daseins, ich
überschaue die Welt, ihre schrofferen und gelinderen Täler
und ihre fruchtbaren Weiden, meine Seele wird über sich selbst und
über alles erhaben und sehnt sich nach dem nähern Himmel.
(13/256)
30 Vgl. oben, Anm. 4.
31 Merkl,
S. 222. Merkl schließt aber aus diesem Sachverhalt ganz
unangemessen, die Novelle
ende mit dem Schein der
Versöhnung. Ihre Schönheit ist gestellt, der Zweck banal.
(S. 222)
32 Möbius, S. 122, verlegt den wartenden Löwen in das Postszenium, was der seitlichen Lage des neu angelegten Ganges widerspricht.
33 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, §49, B 192/93.
34 Die
Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und
so, daß die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar
bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch
unaussprechlich bliebe. Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in
einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, daß der Begriff
im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu
haben und an demselben auszusprechen sei.
(12/470f, Maximen und
Reflexionen)
35 Nimmt man die Kantische Definition der ästhetischen Ideen oder die Goethesche des Symbols ernst, so scheidet jede Interpretation aus, die ein Kunstwerk auf den Begriff zu bringen unternimmt. Es kann immer nur darum gehen, Assoziationsräume zu eröffnen. Das heißt jedoch nicht, daß Interpretationen beliebig seien. Jeder Assoziationsraum sollte zumindest in sich konsistent und mit dem Werk kompatibel sein. Daß mehrere, theoretisch unendlich viele Assoziationsräume zu einem Werk denkbar sind, die untereinander auch nicht kompatibel sein mßssen, heißt also nicht etwa, jede Interpretationen sei vertretbar.
36 Vgl.
Jürgen Brummack, Blankes Schwert erstarrt im Hiebe.
Eine
motivgeschichtliche Bemerkung zu Goethes Novelle
. In:
Getempert und gemischet
. FS für W. Mohr. Hrsg. v. F.
Hundsnurscher u.a., Göppingen 1972, S. 355-376, bes. S. 357.
37 Eine
weitere Parallele, die wir hier aber nicht diskutieren, liegt im
erlassenen Menschenopfer in der Iphigenie
.
38 Vgl.
z.B. Der Gott und die Bajadere
; Götz von
Berlichingen
, V, Weislingens Schloß, 4/169; Iphigenie auf
Tauris
, III/1, 5/36; Die natürliche Tochter
, III/4,
5/263;
, 3. Akt, Vor dem Palaste des Menelas zu
Sparta, 3/275.Faust II
39 Vgl.
v.a. Staiger, S. 74: Die ersten Zeilen [der die
Novelle
abschließenden Strophe] übertreffen an Kindlichkeit das
Frühere noch. Gute Kinder, selger Engel, böses Wollen,
schöne Tat — so allgemein und einfach wird das
unterschieden, wie es für den Sinn der Kleinen faßlich ist.
Den zweiten Teil der Strophe aber füllt ein weit gespanntes und
verflochtenes Satzgebilde aus, desgleichen bisher in dem ganzen Lied
nicht anzutreffen war. Bei näherer Betrachtung findet sich sogar
eine kühne, wenngleich verschleierte apo
koinu
-Konstruktion: Das Ihn, des Waldes Hochtyrannen
ist
Objekt sowohl von so beschworen
wie von fest zu bannen
.
Nach dem schlichten Anfang nötigt uns das schier ein Lächeln
ab. Wir haben das Gefühl, dem Kind gelinge hier ganz absichtslos
noch etwas wie ein kleines Fugato. So beschwören
hält
gewissermaßen das obere Thema aus, während der Infinitiv mit
zu
die zweite Stimme weiterführt; und die apo
koinu
-Konstruktion ergäbe, um in dem musikalischen Gleichnis
zu bleiben, eine Art von enharmonischer Verwechslung [ein weiteres
'Ineinanderschieben'!]. Solche Künstlichkeit scheint uns am Ende
nochmals anzudeuten, wie das Unberührt-Naive sich von selbst zum
Geist erhebt, wie die Kunst als Blüte aufsteigt aus den
Blättern der Natur und eine leichtgeschwungene Brücke von den
Morgenländern zu der hochgebildeten Gesellschaft später Zeit
hinuberführt.
40 Gerhard
Kaiser, Zur Aktualität Goethes. Kunst und Gesellschaft in seiner
Novelle
. In: Jb. dt. Schillerges. 29, 1985, S. 248-265, hier S.
264.
41 Eckermann, S. 196.
42 Wem
diese Schlußfolgerung zu kraß erscheint, sei auf Ernst
Beutlers Aufsatz: Ursprung und Gehalt von Goethes Novelle
. In:
Dvjs 16, 1938, S. 324-352 verwiesen. Beutler kommt zwar zu ganz anderen
Ergebnissen, trägt aber zu Beginn mehrere Belegstellen dafür
zusammen, daß Goethe sich im Alter von den 'Weltbegebenheiten'
mit Verachtung abwandte.
Abbildung 1:
Polarität und Steigerung in der Rede des Schaustellers
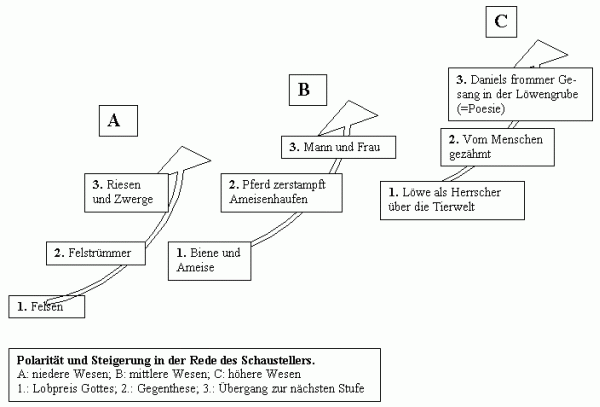
<http://www.isc.meiji.ac.jp/~mmandel/goethe_novelle.html>